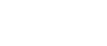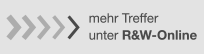Von der transatlantischen Wirtschaftsintegration zur internationalen Sozialen Marktwirtschaft

5700 Kilometer Wasser trennen Europa und Nordamerika voneinander. Was aber der atlantische Ozean trennt, verbindet eine einzigartige Zahl von Grundwerten und gemeinsamen Prinzipien. Weil Europa mit keiner anderen Weltregion fester verbunden ist als mit Nordamerika, sprach Hannah Arendt zu Recht von einer “gesamtatlantischen Zivilisation”. Die beidseitige Anerkennung von Grundwerten wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit stellt bis heute das Fundament der transatlantischen Beziehung dar, deren Bestehen jedoch zu lange als selbstverständlich angenommen wurde. Statt die ihr innewohnenden Potentiale mit dem erforderlichen Maß an politischem Engagement und Interesse zu fördern, wurde sie lediglich mit wohlwollender Gleichgültigkeit, zuletzt geradezu mit latentem Misstrauen bedacht.
Eine Entwicklung, die umso fataler erscheint, je genauer man die globalen Entwicklungen betrachtet: Rasant im wirtschaftlichen Bereich sowie langsam und schleichend im politischen Sektor verschieben sich die Koordinaten der Kraftfelder auf dieser Welt. Schon im Jahr 2030 werden sich die wirtschaftlichen und politischen Gravitationszentren in die aufstrebenden asiatischen Staaten verlagert, die USA und EU hingegen deutlich an Bedeutung eingebüßt haben. Heute jedoch vereinen beide als leistungsstärkste Wirtschaftsräume der Welt noch über 60 % des global erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukts auf sich. Damit besitzen sie die Kraft und Fähigkeit, die Globalisierung in ihrem Sinne zu gestalten – vorausgesetzt, beide Räume arbeiten stärker als bisher zusammen. Genau dieses Ziel verfolgt die EU mit der auf dem letzten EU-USA-Gipfel unter deutschem Vorsitz vereinbarten Initiative zur Vertiefung der transatlantischen Wirtschaftsintegration.
Die Umsetzung einer solchen neuen und engeren Wirtschaftspartnerschaft ist mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Nach innen bietet der konsequente Abbau noch bestehender nicht-tarifärer Handelshemmnisse neue, vielversprechende Möglichkeiten zur Schaffung einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit und damit für mehr Wohlstand für alle Bürger auf beiden Seiten des Atlantiks. Allein die vollständige Öffnung des transatlantischen Luftfahrtmarktes, für die der Anfang des Jahres erzielte Durchbruch nur ein erster Schritt sein kann, brächte für die Luftfahrtbranche eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von jährlich fast 7 Mrd. Euro. Eine Harmonisierung der Wertpapiermärkte könnte die Transaktionskosten um über 50 % senken. Auch die Automobilindustrie könnte durch die Vereinheitlichung der auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedlich ausgestalteten Sicherheits-, Produktzulassungs- und Testverfahren einen enormen Entwicklungsschub erhalten und immense Wachstumspotentiale realisieren. Ähnliches gilt für eine Harmonisierung der Rechnungslegungsgrundsätze, die Vereinheitlichung der Vorschriften über die Aufhebung von Börsennotierungen an den US-amerikanischen Aktienmärkten, die Energiepolitik sowie Handelssicherheit. Mittelfristig könnten die EU und USA gemeinsam erfolgreiche Instrumente zur Bewältigung des demographischen Wandels und der fortschreitenden Deindustrialisierung entwickeln. Eine engere Wirtschaftspartnerschaft würde aber auch eine positive Wirkung gegenüber Drittländern entfalten. So würden einheitliche Regeln und Standards die Marktzugangskosten für Dritte senken – ein Vorteil, der besonders exportorientierten Entwicklungsländern zugute käme. Deshalb wäre ein integrierter transatlantischer Wirtschaftsraum auch eine gute Ergänzung zum multilateralen System der WTO. Denn ganz bewusst soll die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft offen sein für alle Länder, die die Idee der Förderung von freiem Handel und Investitionen teilen. Zeitgleich mit den Gesprächen zwischen der EU und den USA ist deshalb auch Kanada mit dem Ziel eines raschen Beitritts zu diesem einheitlichen Rahmen in die Verhandlungen eingebunden. Als Vorbild für die schrittweise wachsende Integration einer solchen transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft kann der integrierte europäische Wirtschaftsraum dienen, der sich vom gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl zu einem umfassenden Binnenmarkt entwickelt hat. Warum sollten nicht auch zwischen der EU und Nordamerika binnenmarktähnliche Strukturen entstehen?
Vor allem aber haben die USA und die EU jetzt noch die Chance, gemeinsam weltweit gültige und durchsetzungsmächtige Standards zu setzen – und das nicht nur im Sinne einheitlicher Maße und Gewichte oder Verpackungsnormen. Vielmehr könnte einer starken transatlantischen Rechts- und Werteordnung Vorbildcharakter für die gesamte Welt erwachsen. In einem auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basierenden, an den Grundsätzen der Marktwirtschaft orientierten Wirtschaftsraum können gemeinsame Regel für den Kampf gegen Korruption, für einen fairen Wettbewerb und für mehr Transparenz entwickelt werden. Jenseits von Überheblichkeit und Protektionismus könnte der transatlantische Wirtschaftsraum unter Beweis stellen, dass nur eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung, die auf den Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Sicherung ausgelegt ist, einen Wirtschaftsraum langfristig erfolgreich macht. Die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft könnte zur Keimzelle werden für eine internationale soziale Marktwirtschaft, die sich an den Grundsätzen der Transparenz, der Fairness und der Chancengerechtigkeit orientiert.
Matthias Wissmann, Präsident des VDA, Frankfurt/M.