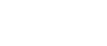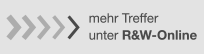Blockchain im Mainstream: GENIUS Act und Europas Antwort
Europas Antwort sollte entschlossen, geschlossen und mutig ausfallen.

Der deutsche, europäische und globale Zahlungsverkehr befindet sich in einem weitreichenden Transformationsprozess. Mit dem Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act, Public Law No. 119-27, 139 Stat. 419) sind die USA unter US-Präsident Trump im Sommer 2025 in eine neue Ära gestartet: Blockchainbasierte Zahlungssysteme mit privaten Stablecoins schicken sich an, aus dem Dollarraum heraus den Mainstream zu erobern. Der GENIUS Act will dabei Interoperabilität, technologische Offenheit und Innovation im Zahlungsverkehr sichern. Insellösungen sollen verhindert werden. Digitales Zentralbankgeld wird konzeptionell abgelehnt. Standardisierte Schnittstellen, Wettbewerb zwischen privaten Anbietern und eine technologieneutrale Regulierung sollen die bereits bestehende Dominanz von in US-Dollar denominierten Stablecoins festigen und ausbauen. Das gesamte US-Ökosystem für blockchainbasierte Zahlungsinnovationen wird sichtbar in seiner Attraktivität gestärkt.
Europa muss darauf kraftvoll reagieren. Die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR, ABlEU vom 9.6.2023, L 150, 40) und die Planungen für einen digitalen Euro können dafür nur als Ausgangspunkt dienen. Der GENIUS Act hat den Maßstab grundlegend verschoben. Die USA regulieren nicht nur, sondern gestalten aktiv Wachstums- und Innovationsräume: strategische Standortpolitik im digitalen Zahlungsverkehr. Europa darf sich nicht als Hort von Bedenkenträgern erweisen, sondern muss mutig eigene Duftmarken setzen. Datenschutz, Stabilität und Inklusion stellen wichtige Anliegen dar, aber sie dürfen die technologische Wettbewerbsfähigkeit nicht aus dem Blickfeld verdrängen. Im globalen Wettbewerb um Zahlungsverkehrssysteme und -produkte darf Europa nicht wieder den Anschluss verlieren.
Die europäische Antwort sollte zwei Dimensionen einbeziehen. Erstens: technologische Innovation. Der digitale Euro darf nicht lediglich als währungsrechtliches Bargeld-Äquivalent verstanden werden. Vielmehr geht es um Interoperabilität mit dezentralen (und privatwirtschaftlichen) Netzwerken, um programmierbare Zahlungen (smart contracts), das Internet der Dinge (IoT) und Industrie-4.0-Prozesse. Während die USA Stablecoins mit regulatorischem Rückenwind in die Alltagsökonomie implementieren, darf Europa sich nicht mehr mit Pilotprojekten begnügen. Zur Innovationsschaffung ist aber auch die europäische Zahlungsindustrie aufgerufen. Projekte wie das der Deutschen Kreditwirtschaft und des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zu Giralgeldtoken (Commercial Bank Money Token – CBMT) müssen europaweit etabliert und skaliert werden. Zweitens: rechtliche Wettbewerbsfähigkeit. Die MiCAR bildet ein solides Fundament, das aber weiterentwickelt werden muss. In ihrem Denken ist sie in Teilen zu stark noch einem Abwehrreflex gegenüber der zwischenzeitlich gescheiterten Libra-/Diem-Initiative verhaftet. Aber kann die MiCAR im Wettbewerb mit dem GENIUS Act bestehen? Hier sind Fragezeichen angebracht. Der GENIUS Act setzt auf Flexibilität und Marktöffnung. Europa muss vergleichbare Aktionsräume schaffen, ohne seine Grundwerte zu opfern. Im Fokus stehen dabei effiziente Zulassungsverfahren auch für neue Marktteilnehmer, Rechtssicherheit für Distributed-Ledger-Technology-(DLT-)Finanzprodukte auch jenseits von Pilotregelungen und klare Regeln zur Interoperabilität zwischen traditionellen Bank- und neuen Kryptodienstleistungen. Überdies zeigt der GENIUS Act, dass innovationsfördernde Kryptogesetzgebung innerhalb weniger Monate ein Gesetzgebungsverfahren vollständig durchlaufen kann – die MiCAR benötigte rund drei Jahre vom Kommissionsvorschlag bis zum Amtsblatt.
Spätestens seit dem GENIUS Act ist offensichtlich, dass nichts weniger als die europäische Souveränität im Zahlungsverkehr auf dem Spiel steht. Wird Europa im kommenden Jahrzehnt ein Mitgestalter oder ein Regelnehmer der globalen Zahlungsinfrastruktur sein? Der geopolitische Wettbewerb zeigt sich längst auch als Infrastrukturwettbewerb, der sich bei den Protokollstrukturen, Standards, Schnittstellen und Plattformen entscheidet. Wer Standards setzt, prägt (auch Zahlungs-)Märkte. Regulierung schützt nicht nur, sondern schafft auch Standorte.
Der GENIUS Act ist deshalb ein ultimativer Weckruf für Europa. Die Antwort sollte entschlossen, geschlossen und mutig ausfallen. Europa darf nichts weniger als die Innovationsführerschaft anstreben. Dazu gehören Innovation und Regulierung, Privatwirtschaft und Zentralbanken, Moderne und Tradition.
Prof. Dr. Sebastian Omlor ist Direktor des Instituts für das Recht der Digitalisierung an der Universität Marburg und Mitherausgeber der Zeitschrift “Recht der Zahlungsdienste”.