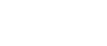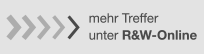Der Zollkonflikt mit den USA spitzt sich zu – was tun?
Seit Monaten dominiert US-Präsident Trump die globale Debatte über die Zukunft der Weltwirtschaft. Die Vereinigten Staaten bleiben zwar die führende Wirtschaftsmacht, sehen sich jedoch zunehmend im Wettbewerb mit China und aufstrebenden Nationen wie Indien. Das Lieblingsvokabular des Präsidenten lautet: “Tariffs” – Zölle als vermeintlich schärfste Waffe im geopolitisch-ökonomischen Kampf um die globale Vormachtstellung.
Bereits in Trumps erster Amtszeit, retrospektiv als Trump 1.0 bezeichnet, belegten die USA ausgewählte EU-Produkte mit Strafzöllen. Im Fokus standen und stehen seither Stahl, Aluminium und Kraftfahrzeuge. Die unter Präsident Biden ausgesetzten Maßnahmen wurden von Trump in seiner zweiten Amtszeit (Trump 2.0) nicht nur reaktiviert, sondern im Juni 2025 für Stahl und Aluminium auf imposante 50 % des Warenwerts angehoben. Der Zoll auf Kraftfahrzeuge verbleibt bislang bei 25 %, was im Kontext dieser Zolloffensive fast schon moderat erscheint.
Seit seiner Rückkehr ins Amt als 47. Präsident der Vereinigten Staaten greift Trump nahezu hemmungslos zur sogenannten “Zollkeule”, gerichtet gegen China, Kanada, Mexiko, die Europäische Union und viele weitere Staaten. Die Abfolge von Ankündigungen, Einführungen und Rücknahmen ist derart erratisch, dass selbst gut informierte Juristen Mühe hab3en, den aktuellen Rechtsstand verbindlich zu erfassen. Trump 2.0 regiert nicht mehr primär über klassische Kanäle, sondern über “soziale Medien” wie “Truth Social” oder “X”, die inzwischen sogar offizielle Verlautbarungsorgane des Weißen Hauses ersetzen. Rechtsgültigkeit erhalten die Maßnahmen freilich erst durch Publikation in den amtlichen Verkündungsblättern, eine Formalie, die zunehmend zur Nebensache verkommt. Die Unberechenbarkeit ist kein Defizit, sondern erklärtes Stilmittel. Sie trifft Unternehmen, Bürger, internationale Partner und nicht zuletzt die eigene Verwaltung gleichermaßen. Rechtsstaatlichkeit? Ein Luxusgut in Trumps politischem Arsenal. Die Devise lautet: “Flood the zone”, also das System mit einer Flut von Maßnahmen, Kehrtwenden und Provokationen zu überfordern, bis Widerstand ermattet. Ein Strategiehandbuch, das bereits unter Trump 1.0 zur Anwendung kam, nun jedoch zur Maxime erhoben wurde.
Auch in der internationalen Handelspolitik folgt das Drehbuch einem bekannten Muster. Nach wochenlangen Drohungen und vagen Ankündigungen zündete der US-Präsident am 2.4.2025 seine vermeintlich “ultimative” Zollbombe. An diesem Tag verhängte er willkürlich einen Basiszollsatz von 10 Prozent auf sämtliche Importe sowie sogenannte “reziproke Zölle” – individuell festgelegte Zusatzzölle gegen fast alle Handelspartner. Trump selbst stilisierte den Tag zum “Tag der Befreiung”, womit er zum Ausdruck bringen wollte, dass die Vereinigten Staaten sich aus der angeblichen
Die reziproken Zölle, die am sogenannten Liberation Day eingeführt wurden, traten zunächst gar nicht in Kraft. Stattdessen setzte der Präsident sie bis zum 9.7.2025 aus, um betroffenen Staaten die Möglichkeit zu bieten, ihre aus Sicht der USA “unfairen Praktiken” abzustellen und sich auf einen bilateralen “Deal” einzulassen. Großbritannien war das erste Land, das eine Vereinbarung abschloss. Die Briten konnten für ihre Fahrzeugindustrie Zollvergünstigungen sichern, mussten dafür jedoch ihren Agrarmarkt weit für US-Produkte öffnen. Mit China existiert eine vorläufige Einigung, die teilweise Zollrücknahmen und erleichterte Exportkontrollen vorsieht – ein Ergebnis des Drucks aus der US-IT-Industrie, die auf Seltene Erden aus China angewiesen ist.
Noch vor Ablauf der Frist wurde sie durch Präsident Trump auf den 1.8.2025 verlängert. Am 12.7.2025 jedoch verschickte er an zahlreiche Handelspartner, darunter die EU, diplomatisch verbrämte Drohbriefe, die stilistisch eher an Hollywoods Mafiafilmklassiker erinnern. Der EU wurde neben dem bereits verhängten Zollsatz von 10 Prozent ein zusätzlicher genereller Zoll von 30 Prozent auf sämtliche nicht bereits betroffene Produkte angedroht.3 Zugleich inszenierte sich Trump als großzügiger Herrscher, der der EU eine Schonung in Aussicht stellte – sofern diese sämtliche Marktzugangsbeschränkungen für US-Produkte aufhebe. Dazu zählen neben Zöllen auch nicht-tarifäre Hemmnisse wie Verbraucherschutzvorgaben, Lebensmittelvorschriften und Wettbewerbsregeln. Darüber hinaus erwartet Trump von europäischen Unternehmen erhebliche Investitionen in den USA, um seine Vision einer Re-Industrialisierung zu erfüllen. Dass bei nahezu voller Beschäftigung in den Vereinigten Staaten kaum Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und Umfragen zufolge 80 % der US-Bürger kein Interesse an Industriearbeit haben, kümmert ihn dabei wenig. Stattdessen werden Migranten abgeschoben, obwohl gerade diese als Arbeitskräfte infrage kämen. Das “Project 2025” zeigt hier deutlich eine Inkohärenz zwischen den Politikfeldern Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Migration.
Sollte es tatsächlich zur Einführung eines generellen Zollsatzes von insgesamt 40 Prozent auf sämtliche EU-Importe in die USA kommen, wären auch jene Bereiche der deutschen Exportwirtschaft betroffen, die bislang von sektorspezifischen Maßnahmen verschont blieben. Unternehmen der Agrar- und Lebensmittelbranche mit Absatz- oder Produktionsstandorten in den USA würden erheblich unter zusätzlichem finanziellem Druck stehen. Neben den bereits bestehenden lebensmittelrechtlichen Vorgaben kämen nun empfindliche Zollbelastungen hinzu.
An dieser Stelle sei klargestellt: Den Zoll zahlt nicht das Exportland, sondern der Importeur im Zielland. Am Ende trifft es den amerikanischen Konsumenten. Es grenzt an bewusste Irreführung der Wählerschaft, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten öffentlich suggeriert, ausländische Staaten – etwa die EU oder China – müssten die Zölle entrichten. Faktisch wird der Zoll vom US-Importeur an die amerikanische Staatskasse abgeführt, in aller Regel also von US-Unternehmen. Ausnahmen kann es geben, wenn ein deutscher Lieferant sich vertraglich verpflichtet hat, eventuelle Einfuhrzölle zu zahlen. Eine Vertragsbedingung, die handelsrechtlich möglich ist und in der Praxis von vielen Einkäufern verlangt wird, aber niemals zu empfehlen ist. Oder das deutsche Unternehmen liefert an ein Tochterunternehmen in den USA. Dann wird die Kostentragung im Konzern ein Thema sein.
Unabhängig von der konkreten Vertragsgestaltung können hohe Zölle das Exportvolumen massiv beeinträchtigen, was sich unmittelbar negativ auf die betroffenen Unternehmen auswirkt. Zölle führen aus volkswirtschaftlicher Sicht fast immer zu einem sogenannten “lose-lose”-Effekt – beide Seiten verlieren. Betriebswirtschaftlich profitieren nur jene Unternehmen, die ausschließlich innerhalb der USA produzieren und keine importierten Vormaterialien benötigen. Deren Gewinnmargen steigen, weil konkurrierende Fertigerzeugnisse aus dem Ausland durch Zölle verteuert werden, während die eigenen Produktionskosten stabil bleiben. Diese Unternehmen erhöhen ihre Preise, und der amerikanische Verbraucher zahlt den Preis – buchstäblich und bildlich.
Wie viele andere Staaten nutzt auch die Europäische Union den vom US-Präsidenten bis zum 9.7.2025 gewährten – und inzwischen auf den 1.8.2025 verlängerten – Zeitraum für Verhandlungen. Bereits im Jahr 2018 hatte die EU als Reaktion auf die damaligen US-Zölle Gegenzölle auf symbolträchtige US-Produkte wie Whiskey, Jeans oder Motorräder eingeführt. Am 14.4.2025 wurde die entsprechende Verordnung überarbeitet und eine Ausweitung der Gegenmaßnahmen beschlossen.4 Allerdings wurde deren Anwendung gleichzeitig für 90 Tage ausgesetzt, um Verhandlungen mit den USA zu ermöglichen.5 Am 13.7.2025 kündigte die Präsidentin der EU-Kommission an, die Aussetzung bis zum 1.8.2025 zu verlängern.6
Als mögliche Gegenmaßnahme plant die EU die Einführung von Retorsionszöllen. Die Verordnung vom 14.4.2025 enthält bereits eine Liste potenzieller US-Produkte, für die beim Import ein Zollsatz von 25 Prozent gelten soll. Betroffen wäre auch die Agrar- und Lebensmittelbranche. Der Anhang zur Verordnung folgt der Zolltarifstruktur und erfasst unter anderem verarbeitetes Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideerzeugnisse und Lebensmittelzubereitungen.7 Im Mai und Juni 2025 hat die EU-Kommission den betroffenen Warenkreis deutlich erweitert und ein Konsultationsverfahren
Alle Unternehmen der Lebensmittelindustrie, die Produkte aus den Vereinigten Staaten beziehen, sollten sich frühzeitig auf potenzielle Zollbelastungen einstellen. Ab August 2025 könnten auf Grundlage der aktuellen Verordnung Zölle in Höhe von 25 Prozent fällig werden. Im Regelfall wird der deutsche Importeur zur Entrichtung dieser Abgaben gegenüber der EU verpflichtet sein. Eine Preissteigerung in der EU ist die Folge.
Mit der Einführung von Gegenzöllen schießt die EU aus ökonomischer Sicht ein Eigentor. Sie birgt das Risiko einer Eskalation, die rasch in einen umfassenden Handelskrieg münden kann. Importierende Unternehmen werden erheblich belastet, und die Folgen tragen letztlich auch die Verbraucher. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen ist es für Unternehmen unerlässlich, alternative Bezugs- und Absatzmärkte zu prüfen oder auszubauen.
Die Europäische Union arbeitet unterdessen an einer strategischen Neuausrichtung ihrer Handelspolitik mit dem Ziel, die wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA zu reduzieren. Parallel zu den Verhandlungen mit Washington strebt Brüssel an, mit anderen Staaten oder Staatengruppen eine regelbasierte, liberale Handelsordnung zu erhalten oder neu zu etablieren. Beim EU-Gipfel am 28.6.2025 überraschte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Vorschlag, die Zusammenarbeit mit dem pazifischen Freihandelsbündnis CPTPP zu intensivieren.9 Bisher wurde der multilaterale Ansatz zugunsten bilateraler Abkommen mit Ländern der Asien-Pazifik-Region vernachlässigt. Angesichts neuer geoökonomischer Blockbildungen erhält dieser Vorschlag jedoch zusätzliche Relevanz.
Das CPTPP umfasst die Staaten Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Es ist seit 2019 für die meisten Mitglieder in Kraft und ging aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) hervor, aus der sich die USA 2017 unter Präsident Trump zurückzogen. Das Abkommen regelt nicht nur den Waren- und Dienstleistungshandel, sondern auch Aspekte wie digitalen Handel, geistiges Eigentum, öffentliche Auftragsvergabe, Korruptionsbekämpfung, Arbeitsstandards sowie Wettbewerbsregeln für Staatsunternehmen. Darüber hinaus trägt es zum Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten bei.
Das Vereinigte Königreich trat dem CPTPP nach dem EU-Austritt bei; der Beitrittsprozess wurde im Dezember 2024 abgeschlossen. Damit ist erstmals ein Staat außerhalb der asiatisch-pazifischen Region Teil dieses Freihandelsnetzwerks. Die Europäische Union unterhält zwar mit den meisten CPTPP-Mitgliedern bereits bilaterale Abkommen – nur Australien, Brunei und Malaysia fehlen –, doch reicht dies nicht aus, um ihre strategische Position in der Region nachhaltig zu stärken.
Die im Jahr 2021 formulierte globale Handelsstrategie der EU betonte die Stärkung der WTO und die transatlantische Partnerschaft. Beides erscheint heute zunehmend fragil. Der Multilateralismus schwächelt, die transatlantischen Beziehungen sind belastet. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass die EU neue Optionen prüft. Ein Beitritt zum CPTPP, analog zum Vorgehen Großbritanniens, wäre ein sinnvoller Schritt.10
Die EU könnte dem CPTPP ein deutliches globales Gewicht verleihen. Da sowohl die EU als auch die CPTPP-Mitglieder hohe Standards beim Umwelt- und Sozialschutz verfolgen, wäre die Partnerschaft auch normativ kompatibel. Gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich könnte die EU ein neues internationales Netzwerk aufbauen, das die bisherigen multilateralen Strukturen erweitert.
Als Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, sollte sich die EU angesichts der veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht allein auf die Welthandelsorganisation verlassen. Sie sollte neue institutionelle Formate nutzen, um ihre Interessen zu vertreten. Die Rede ist bereits von einer “WTO 2.0”.11 Ein verstärktes Engagement im asiatisch-pazifischen Raum eröffnet neue Chancen – nicht als Ersatz für den US-Markt, aber als wichtige Ergänzung. Die geoökonomischen Verschiebungen sind Herausforderung und Chance zugleich, für die EU ebenso wie für international agierende Unternehmen.
Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Münster
| 1 |
| 2 | www.heritage.org/conservatism/commentary/project-2025. |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 | Groser/Verheul/Clarke, Comment: Operationalising Ursula von der Leyen's CPTPP ambitions, Borderlex, 01/07/2025 https://borderlex.net/2025/07/01/comment-operationalising-ursula-von-der-leyens-cptpp-ambitions/. |
| 10 | Allard/ Grare, European trade and strategy in the Indo-Pacific. Why the EU should join the CPTPP, European Council on Foreign Relations, December 2021https://ecfr.eu/article/european-trade-and-strategy-in-the-indo-pacific-why-the-eu-should-join-the-cptpp/. |
| 11 |