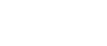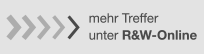Die Haftung von Geschäftsführern und Vorständen für gegen das Unternehmen verhängte Kartellbußgelder – ein weiteres Kapitel
I. Einleitung
Ob Geschäftsführer einer GmbH und Vorstände einer AG diesen Gesellschaften für Bußgelder haften, die Kartellbehörden gegen die Gesellschaft verhängt haben, ist seit vielen Jahren eine (auch in dieser Zeitschrift) intensiv diskutierte Frage.1 Auch die Rechtsprechung der Instanzgerichte ist nicht einheitlich.2 Der BGH hatte zuletzt über eine Berufung gegen ein Urteil des OLG Düsseldorf zu entscheiden, in dem das OLG die Haftung eines Geschäftsführers einer GmbH nach § 43 Abs. 2 GmbHG abgelehnt hatte. Das OLG Düsseldorf hielt eine Haftung des Leitungsorgans für unzulässig, weil § 43 Abs. 2 GmbHG aufgrund des in §§ 81a bis 81d GWB geregelten Sanktionszwecks teleologisch zu reduzieren sei.3
Der Rechtsstreit geht auf eine Bußgeldentscheidung des Bundeskartellamtes gegen Unternehmen der Stahlindustrie zurück. Dieses Verfahren richtete sich u.a. gegen zwei konzernverbundene Unternehmen der Edelstahlbranche, von denen eines in der Rechtsform der GmbH die operativen Geschäfte führte und das andere als Holdingunternehmen in der Rechtsform der AG sämtliche Anteile an der operativen Gesellschaft hielt. Der Geschäftsführer der GmbH war zugleich Vorstandsmitglied (und zeitweise Vorstandsvorsitzender) der AG. Er war nach den – bestandskräftigen – Feststellungen des Bundeskartellamtes über mehr als zehn Jahre an Kartellabsprachen beteiligt, aufgrund derer die daran beteiligten Unternehmen Preiswettbewerb vermeiden oder jedenfalls
Das Bundeskartellamt führte zunächst gegen beide Konzernunternehmen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, stellte das Verfahren gegen die Holdinggesellschaft aber aus Ermessensgründen ein. Gegen die operativ tätige GmbH wurde nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB wegen Verstößen gegen §§ 1, 2 GWB und Art. 101 Abs. 1 AEUV ein Bußgeld in Höhe von EUR 4,1 Mio. verhängt und gegen deren (im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundeskartellamtes ehemaligen) Geschäftsführer (und Vorstand der Holdinggesellschaft) ein Bußgeld in Höhe von EUR 126 000. Die beiden Gesellschaften nahmen daraufhin den Geschäftsführer auf Ersatz des gegen die GmbH verhängten Bußgeldes sowie auf Ersatz der bei der AG entstandenen Aufklärungs- und Rechtsverteidigungskosten in Höhe von EUR 1,14 Mio. in Anspruch. Daneben verlangten sie die Feststellung, dass der Geschäftsführer auch für Folgeschäden haftet, die aus dem Kartellrechtsverstoß resultieren – etwa Schadensersatzansprüche von Kunden der GmbH nach § 33a GWB.
Das Landgericht4 und das OLG Düsseldorf5 lehnten einen Regress für die Geldbußen wegen Kartellrechtsverstößen ab. Ein solcher zivilrechtlicher Binnenregress nach § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 S. 1 AktG widerspreche dem Sanktionszweck des § 81 GWB, vereitele also den Zweck der kartellrechtlichen Unternehmensbuße.
Der BGH hat sich einer eigenen Entscheidung der Rechtsfrage (zunächst) enthalten und das Verfahren ausgesetzt. Dem EuGH wurde zur Vorabentscheidung die Frage vorgelegt, ob Art. 101 AEUV einer Regelung im nationalen Recht entgegensteht, nach der eine juristische Person, gegen die eine nationale Wettbewerbsbehörde ein Bußgeld wegen eines durch ihr Leitungsorgan begangenen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV verhängt hat, den ihr dadurch entstandenen Schaden von dem Leitungsorgan ersetzt verlangen kann.6
Damit hebt der BGH die Streitfrage auf eine weitere, europarechtliche Ebene und überlässt die Klärung Luxemburg. Das kann man bedauern und meinen, dass eine Vorlage zum EuGH nicht notwendig gewesen wäre, weil sich die Frage bereits unter Anwendung des nationalen Rechts beantworten ließe. Unabhängig davon deutet der BGH in der Entscheidung Zweifel an einer unbeschränkten Anwendung der gesellschaftsrechtlichen Haftungsnormen (§ 43 GmbHG, § 93 AktG) jedenfalls dann an, wenn es um die Haftung für Bußgelder wegen Verstößen gegen das europäische Kartellverbot geht. Sollte der EuGH diese Zweifel bestätigen, hätte dies erhebliche Folgen für die von Kartellbußen betroffenen Unternehmen ebenso wie für deren Leitungsorgane.
II. Kartellrechtliche Begrenzung zivilrechtlicher Haftung?
In der Entscheidung verweist der BGH zunächst auf die Sorgfaltspflicht von Geschäftsführern nach § 43 Abs. 1 GmbHG, bei deren Verletzung sie nach § 43 Abs. 2 GmbHG der Gesellschaft auf den dadurch entstandenen Schaden haften. Danach haben die Geschäftsführer dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft sich rechtmäßig verhält. Eine Pflichtverletzung sei auch nicht deswegen ausgeschlossen, weil das gesetzwidrige Handeln des Geschäftsführers für die Gesellschaft vorteilhaft war.7 Solche Vorteile könnten dann entstehen, wenn die Gesellschaft durch den Kartellrechtsverstoß z.B. höhere Preise realisieren, weniger Wettbewerbsdruck befürchten oder Aufträge bearbeiten kann, die sie andernfalls nicht erhalten hätte.8 Zudem unterstellt der BGH unter Verweis auf die Vorinstanz ein vorsätzliches Handeln des Geschäftsführers bei der Pflichtverletzung durch Beteiligung an einem Preiskartell sowie die Entstehung eines Schadens bei der GmbH in Form des gegen sie verhängten Kartellbußgeldes.9
Anschließend befasst sich die Entscheidung mit der Frage, ob ein Regressanspruch der Gesellschaft nach § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 S. 1 AktG “aus Rechtsgründen ausgeschlossen” ist, wenn damit Ersatz für einen Schaden verlangt wird, der durch ein Kartellbußgeld entstanden ist. Dies wäre nur mit einer teleologischen Reduktion der Haftungsnormen denkbar, die eine Haftung des Organmitglieds unabhängig davon anordnen, welcher Zweck mit dem schadensauslösenden Bußgeld verfolgt wird. Eine derartige – von den Vorinstanzen angenommene – teleologische Reduktion ergebe sich “jedenfalls nicht zweifelsfrei” aus dem deutschen Recht.10
Dabei erörtert der BGH die wesentlichen Argumente, die in der Literatur und der bisherigen (eher vereinzelten) Rechtsprechung für und wider einen Regress gegen Geschäftsführer und Vorstände für Geldbußen wegen Kartellrechtsverstößen diskutiert worden sind. Im Ergebnis werden die auch von den Vorinstanzen gegen den Bußgeldregress vorgebrachten Argumente aber nicht für ausreichend erachtet, um ohne Rückgriff auf den vom EuGH regelmäßig
1. Wortlaut und Zweck der Organhaftung
Zunächst hebt der BGH hervor, dass eine Haftung von Organmitgliedern für Unternehmensgeldbußen dem Wortlaut der zivilrechtlichen Normen (§ 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 S. 1 AktG) entspricht. Es ergebe sich weder aus dem Gesetz noch aus den Gesetzesmaterialien, dass die Haftung von Leitungsorganen bestimmte Schäden wie die durch Kartellbußgelder verursachten nicht umfassen soll. Der Gesetzgeber habe trotz der breiten wissenschaftlichen Diskussion bei keiner der zahlreichen Änderungen des Kartellbußgeldrechts zivilrechtliche Ersatzansprüche beschränkt.12
Vielmehr entspreche eine umfassende Haftung gerade dem Zweck der Organhaftung. Denn damit könnten die Leitungsorgane zu pflichtgemäßem Handeln angehalten und Kartellrechtsverstöße verhindert werden, ohne dass die Organhaftung Sanktionscharakter habe.13 Diese Verhaltenssteuerung sei wesentlich, weil die Organe das Marktverhalten des Unternehmens maßgeblich beeinflussen und auch die Intensität von Compliance-Programmen steuern.14 In der Literatur und Rechtsprechung ist insoweit betont worden, gerade die Regressmöglichkeit könne das Verhalten der Leitungsorgane in Richtung Kartellrechts-Compliance lenken, so dass die Regressmöglichkeit gerade wesentlich für die Einhaltung des Kartellverbotes sei.15
2. Kein grundsätzlicher Ausschluss der Abwälzung von Verbandsbußen auf Organe
Im nächsten Schritt erkennt der BGH an, dass nach der bisherigen Rechtsprechung Geldstrafen oder Bußgelder nach zivilrechtlichen Regeln im Grundsatz auf Dritte abgewälzt werden können. Das deutsche Sanktionenrecht schließe dies nicht aus. Zwar müsse der Täter einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit die gegen ihn verhängte Sanktion aus dem eigenen Vermögen aufbringen. Mit der Entrichtung dieser Sanktion sei dem Strafanspruch aber Genüge getan.16
Der damit verbundene Vermögensnachteil könne im Anschluss einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten auslösen, wenn das Zivilrecht einen derartigen Ersatzanspruch regele.17 Hierbei verweist der BGH auf die sog. Beraterfälle, wonach Berater von ihren Mandanten auf Erstattung von Geldbußen in Anspruch genommen werden können, die aufgrund der Beratung gerade vermieden werden sollten.18 Ebenso wird darauf verwiesen, dass weder die freiwillige Übernahme einer Geldstrafe durch einen Dritten noch die Bereitstellung der Finanzmittel für eine Geldstrafe vor Begehung der Tat strafrechtlich als Begünstigung oder Strafvereitelung sanktioniert werden.19
3. Ziele des kartellrechtlichen Sanktionssystems
Ein wesentliches Argument der Gegner einer Regressmöglichkeit für Kartellbußgelder geht dahin, dass dadurch der Sanktionszweck unterminiert werde, indem das bußgeldpflichtige Unternehmen zu Unrecht entlastet werde.20 Dem schließt sich der BGH jedenfalls nicht uneingeschränkt an.
Zwar erkennt der BGH an, dass das kartellrechtliche Sanktionssystem nach § 81 und § 81a GWB sowie die Verbandssanktion nach § 30 OWiG dagegen sprechen, ein gegen das Unternehmen verhängtes Bußgeld auf ein Leitungsorgan abzuwälzen. Denn § 30 Abs. 1 OWiG ordne eine eigene bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Verbandes für Verstöße seiner Leitungspersonen an. Die gegen Unternehmen verhängten Geldbußen sollten das Verbandsvermögen und damit denjenigen treffen, der von dem Kartellrechtsverstoß profitiert. Dies ist (wenn aus einer Kartellabsprache überhaupt Vorteile erwachsen)21 in erster Linie das Unternehmen und nicht dessen Geschäftsführung oder Vorstand. Auch die erweiterte bußgeldrechtliche Haftung nach § 81a GWB für Unternehmen, die mit der gegen das Kartellverbot verstoßenden juristischen Person konzernverbunden sind, sowie für Gesamtrechtsnachfolger ziele darauf ab, die unternehmerische Einheit zu sanktionieren. Dies gelte auch, wenn das Kartellbußgeld – wie in dem zu entscheidenden Fall – nicht der Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile diene, sondern ausschließlich ahndenden Charakter habe. Denn auch dann richte sich dessen Höhe vorranging nach dem vom Unternehmen erzielten tatbezogenen Umsatz.22
Mit diesen Zielen des kartellrechtlichen Sanktionenrechts sei eine Inanspruchnahme des Leitungsorgans für die gegen das Unternehmen verhängte Geldbuße nicht ohne weiteres vereinbar. Es kommt hinzu, dass das deutsche Recht in § 81c GWB für natürliche Personen und das Unternehmen unterschiedliche Bußgeldrahmen vorsieht. Während gegen natürliche Personen nach § 81c Abs. 1 S. 1 GWB ein Bußgeld von maximal EUR 1 Mio. verhängt werden kann, können Geldbußen gegen Unternehmen deutlich höher ausfallen und dürfen nach § 81c Abs. 2 GWB 10 % des im Vorjahr erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens nicht übersteigen. Dieser Differenzierung des Bußgeldrahmens widerspräche es, würde man das Leitungsorgan zusätzlich für das gegen das Unternehmen verhängte Bußgeld haften lassen.
4. Kein klarer Vorrang des nationalen Kartellbußgeldrechts vor der Organhaftung
Diese Überlegungen zum nationalen Regelungszweck von Kartellbußgeldern reichen für den Kartellsenat des BGH jedoch nicht aus, um die nationalen zivilrechtlichen Regressansprüche aus § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 S. 1 AktG unangewendet zu lassen.
Zum einen stünden das Sanktionenrecht und die zivilrechtliche Organhaftung gleichrangig nebeneinander; dem Sanktionenrecht sei nicht mit der notwendigen Deutlichkeit zu entnehmen, dass die zivilrechtliche Ordnung damit
Die Möglichkeit, die Regressansprüche der Gesellschaft gegen ein Leitungsorgan bei einer D&O-Versicherung zu liquidieren, erscheint in der Tat nicht ausreichend, um einen Innenregress auszuschließen. Selbst wenn eine Abwälzung auf den D&O-Versicherer möglich wäre, weil diese jedenfalls teilweise auch vorsätzliche Verstöße gegen das Kartellverbot absichern sollen,24 läge es näher, die Versicherbarkeit solcher Risiken mit Rücksicht auf den Sanktionszweck des Kartellverbotes auszuschließen als die Regressmöglichkeit insgesamt.25
5. Unionsrechtskonforme Auslegung der Vorschriften zur Organhaftung
Da das nationale Recht keine ausreichenden Hinweise für den Vorrang des kartellrechtlichen Sanktionssystems vor der zivilrechtlichen Organhaftung zulasse, behilft sich der BGH mit einem Rückgriff auf das europäische Kartellverbot (Art. 101 AEUV).
Nach dem Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts als Folge des Anwendungsvorrangs des europäischen Rechts kann das nationale Recht einschränkend auszulegen sein. Dieser Grundsatz verlangt von den nationalen Trägern öffentlicher Gewalt, unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der dort anerkannten Auslegungsmethoden alles zu tun, was in ihrer Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im Einklang steht. Eine derartige unionsrechtskonforme Auslegung kann zwar nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen.26 Wenn
Tatsächlich regelt das europäische Kartellverbot das Verhältnis zwischen Sanktion für einen Kartellrechtsverstoß und Ersatzanspruch der sanktionierten Gesellschaft gegen das die Sanktion verursachende Leitungsorgan ebenso wenig wie das deutsche Recht. Auch das sekundäre Gemeinschaftsrecht enthält z.B. in Art. 13 ECN+-Richtlinie28 lediglich Vorgaben dazu, dass die Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen Art. 101 und 102 AEUV in der Lage sein müssen, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Geldbußen gegen Unternehmen zu verhängen. Der EuGH hatte bereits vor Inkrafttreten der ECN+-Richtlinie aus dem Gebot der Gemeinschafts- oder Unionstreue (Art. 5 EGV, Art. 10 EGV, Art. 4 Abs. 3 AEUV) und der unmittelbaren Geltung des europäischen Kartellverbotes abgeleitet, dass Bußgelder wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen, wenn sie von nationalen Wettbewerbsbehörden wegen Verstößen gegen Art. 101 und Art. 102 AEUV verhängt werden.29
In einem Urteil aus 2009 hat der EuGH zudem darauf hingewiesen, dass eine Geldbuße wegen Verstoßes gegen das europäische Kartellverbot “sehr viel von ihrer Wirksamkeit einbüßen” würde, wenn das sanktionierte Unternehmen berechtigt wäre, die Geldbuße insgesamt oder teilweise von seinem steuerbaren Gewinn in Abzug zu bringen.30 In dieser Entscheidung hat der EuGH allerdings keine Vorgaben dazu gemacht, ob eine nationale Regelung, welche die steuerliche Abzugsfähigkeit von Geldbußen ermöglicht, von nationalen Behörden und Gerichten unangewendet bleiben muss, um die volle Wirksamkeit des europäischen Kartellverbots zu gewährleisten. Denn in dem Vorlageverfahren hatte der EuGH lediglich die Frage zu beantworten, ob die Europäische Kommission nach Art. 15 VO 1/2003 (Zusammenarbeit der Kommission mit Gerichten der Mitgliedstaaten) berechtigt ist, unaufgefordert
Der BGH vergleicht die steuerliche Abzugsfähigkeit einer Kartellgeldbuße mit einem Regress des mit einem Kartellbußgeld sanktionierten Unternehmens gegen eines seiner Organe nach § 43 Abs. 2 GmbHG oder § 93 Abs. 2 S. 1 AktG. Die Möglichkeit, einen Teil oder sogar das gesamte Kartellbußgeld von einem außerhalb des Haftungsverbands des Unternehmens stehenden Leitungsorgan (oder der D&O-Versicherung) ersetzt zu verlangen, könnte die gebotene Wirksamkeit der gegen das Unternehmen verhängten Geldbuße beeinträchtigen.31
Mit dieser Begründung legt der BGH die Frage nach einem möglichen Verbot des Binnenregresses wegen einer damit verbundenen Beeinträchtigung der Wirksamkeit von Kartellbußgeldern dem EuGH vor.
Ob diese Befürchtung gerechtfertigt ist, könne jedenfalls nicht davon abhängen, ob die zuständige Kartellbehörde neben dem Unternehmen ein Bußgeld auch gegen das Leitungsorgan festgesetzt hat. Diese Möglichkeit besteht nach § 81 Abs. 1 GWB, § 9 OWiG für die deutschen Kartellbehörden, nicht aber für die Europäische Kommission. Diese kann nach Art. 23 Abs. 1 VO 1/2003 nur gegen Unternehmen Bußgelder festsetzen. Wenn ein Leitungsorgan kein eigenes Bußgeld zu tragen hat, hätte die Gefahr einer Inanspruchnahme durch die Gesellschaft ggf. eine disziplinierende Wirkung auf die Entscheidung des Organs, sich für die Gesellschaft an Kartellabsprachen zu beteiligen. Der BGH unterstellt dennoch, dass es aus Gründen der “Rechtseinheitlichkeit” keine unterschiedlichen Vorgaben des Gemeinschaftsrechts für die Wirksamkeit von Kartellbußen abhängig davon geben könne, welche Kartellbehörde die Sanktionen verhängt.
III. Auswirkungen auf den Umgang mit Kartellbußgeldern als Gegenstand von Regressansprüchen
Vorhersagen über die Antwort des EuGH auf die Vorlagefragen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung. Da der EuGH aber sogar die fehlende Haftungsmöglichkeit einer Tochtergesellschaft für das Fehlverhalten ihrer Muttergesellschaft für geeignet hält, die Wirksamkeit des europäischen Kartellverbotes zu beeinträchtigen,32 liegt es jedenfalls keineswegs fern, dass er dies
Es erstaunt allerdings, dass der BGH über diese Frage nicht selbst entschieden hat. Wenn es möglich ist, dass das europäische Kartellverbot einen Regress für Kartellbußgelder ausschließt, verwundert es, dass das deutsche Kartellverbot und die entsprechenden Sanktionsregeln eine derartige Wirkung jedenfalls nicht so eindeutig haben sollen, dass sich daraus eine teleologische Reduktion der Anwendung der Organhaftungsregeln ableiten ließe.
Bis der EuGH über die Vorlagefragen entschieden hat, muss die Praxis damit umgehen, dass die Frage weiterhin ungeklärt ist, ob Geschäftsführer und Vorstände für Kartellbußgelder in Regress genommen werden können. Sofern der Gesetzgeber sich nicht zu einer Regelung der Frage entschließt, wird das für die Geltendmachung von Regressansprüchen im Unternehmen zuständige Organ sicherheitshalber den Lauf der Verjährungsfrist für Regressansprüche hemmen müssen, bis der EuGH entschieden hat.
Nach den ARAG/Garmenbeck-Grundsätzen kann der Aufsichtsrat bei der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Vorstandsmitgliedern für Schäden der Gesellschaft bekanntlich nicht ohne weiteres die sog. Business Judgment Rule anwenden. Er ist vielmehr grundsätzlich zur Geltendmachung von Regressansprüchen verpflichtet, wenn ein Anspruch aus Organhaftung “voraussichtlich durchsetzbar” ist.33 Nach der Entscheidung des BGH vom 11. 2. 2025 ist die Frage nach der “voraussichtlichen Durchsetzbarkeit” nicht viel einfacher zu beantworten als zuvor. Jedenfalls lässt sich daraus kaum ein deutliches Überwiegen einer Durchsetzungswahrscheinlichkeit34 herleiten.
Bedeutsam für die Unternehmenspraxis und den Umgang mit der Frage, ob wegen Kartellbußgeldern Regressansprüche gegen die Leitungsorgane sinnvoll oder sogar rechtlich geboten sind, könnten zusätzlich die im Folgenden dargestellten Gesichtspunkte sein.
1. Keine teleologische Reduktion für Folgeschäden des Kartellrechtsverstoßes
Zunächst betrifft die Vorlagefrage ausschließlich Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegen Leitungsorgane nach § 43 Abs. 2 GmbHG oder § 93 Abs. 2 S. 1 AktG für Schäden, die durch Kartellbußgelder verursacht werden. In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit hatte die AG (Holdinggesellschaft) gegen das ehemalige Vorstandsmitglied zusätzlich Schadensersatz für Kosten
Mit möglichen Schäden der Gesellschaft aus (zukünftigen) Schadensersatzklagen ihrer Kunden wegen kartellbedingt überhöhter Preise befasst sich der BGH in der Vorlageentscheidung nicht. Es liegt allerdings nahe, dass ein Regress beim Organ für derartige Schäden (sofern sie erfolgreich geltend gemacht werden) für den Kartellsenat des BGH die Wirksamkeit der Bußgeldsanktion ebenfalls nicht berühren würde.
Die beiden Vorinstanzen hatten dies jedenfalls teilweise anders gesehen. Sowohl das LG Düsseldorf als auch das OLG Düsseldorf hielten auch einen Binnenregress für Kosten für die Aufklärung des Kartellrechtsverstoßes und für die Verteidigung dagegen für systemwidrig. Diese Kosten seien unmittelbar durch das Bußgeldverfahren und die Verteidigung gegen die Vorwürfe entstanden. Sie müssten deswegen an der teleologischen Reduktion von § 93 Abs. 2 S. 1 AktG und § 43 Abs. 2 GmbHG teilnehmen.36 Lediglich andere auf dem Kartellrechtsverstoß beruhende Schäden (wie z.B. Schadensersatzverpflichtungen gegenüber den Kunden aufgrund des Kartellrechtsverstoßes) sollte das sanktionierte Unternehmen beim Geschäftsführer liquidieren können.
Kosten für die Rechtsverfolgung können erhebliche Summen erreichen. Noch deutlich höher können Schadensersatzansprüche gegen die Gesellschaft ausfallen, die Kunden nach dem Abschluss von Kartellverfahren sehr häufig geltend machen.37 Für derartige Kosten dürfte nach dem Beschluss des BGH jedenfalls keine kartellrechtlich geprägte teleologische Reduktion der Organhaftung gelten.38 Vorstände und Geschäftsführer könnten deswegen für solche Schäden der Gesellschaft in Anspruch genommen werden, sofern dem keine anderen Gründe (wie etwa die Vorteilsausgleichung) entgegenstehen.
Insofern kann zumindest diese Regressmöglichkeit auch in Zukunft Abschreckungspotential auf Geschäftsführer und Vorstände entfalten und die Bemühungen um Compliance-Maßnahmen stärken, wenn der EuGH die Regressierbarkeit von Kartellbußgeldern für mit dem europäischen Kartellverbot unvereinbar halten sollte.
2. Keine Unterscheidung zwischen Verstößen gegen das nationale und das europäische Kartellverbot
Sofern eine deutsche Kartellbehörde ein Kartellbußgeld ausschließlich auf eine Verletzung nationalen Rechts stützt, kann an sich die Wirksamkeit des europäischen Kartellverbotes einem Regress für das Bußgeld nicht im Wege stehen. Nach dem Beschluss des BGH schränkt das deutsche Kartellverbot die Möglichkeit, für Kartellbußgelder die Geschäftsführung in Anspruch zu nehmen, jedenfalls nicht eindeutig ein. Das spräche dafür, dass auch vor einer Entscheidung über die Vorlagefrage Vorstände und Geschäftsführer jedenfalls für solche Kartellbußgelder in Anspruch genommen werden können, die ausschließlich auf einen Verstoß nationalen Kartellrechts gestützt worden sind, z.B. weil der Kartellrechtsverstoß sich nur lokal ausgewirkt hat.
Der BGH hat in seinem Beschluss diese Frage indes anders beantwortet. Das europäische Recht könne das nationale Recht auch in Fällen beeinflussen, in denen das europäische Recht nicht anwendbar ist. Der nationale Gesetzgeber habe mehrfach betont, das nationale Bußgeldrecht an das europäische angleichen zu wollen. Daher sei bei der Anwendung der zivilrechtlichen Organhaftung nicht danach zu differenzieren, ob das Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen das deutsche oder das europäische Recht verhängt wurde.39 Das ist immerhin eine gute Nachricht, die den Umgang mit dem eher salomonischen Beschluss des BGH bis zur Entscheidung des EuGH über die Vorlagefrage etwas erleichtern dürfte.
Kathrin Westermann
| 1 | Vgl. für die Zulässigkeit eines Bußgeldregresses z.B. Thole, ZHR 173 (2009) 504, 532 ff.; Nietsch, ZHR 184 (2020) 60, 69 ff.; Kersting, ZIP 2016, 1266 ff.; Kersting/May, WuW 2024, 313 ff.; gegen die Regressmöglichkeit Ackermann, ZHR 179 (2015) 538, 560 f.; Thomas, NZG 2015, 1409, 1413 f.; Leclerc, NZKart 2021, 220, 222; Leclerc, Der Kartellbußgeldregress, 2022, S. 197 ff.; Wils, WuW 2023, 583 ff.; zum Streitstand im Übrigen vgl. BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 13, 14. |
| 2 | Gegen die Regressmöglichkeit z.B. LAG Düsseldorf, BB 2015, S. 907 ff.; LG Saarbrücken WuW 2021, 62 ff.; für Regressmöglichkeit LG Dortmund, NZKart 2023, 443 ff.; LG Dortmund NZKart 2023, 496 ff. |
| 3 | OLG Düsseldorf v. 27. 7. 2023, VI-6 U 1/22 (Kart), NZG 2023, 1279 ff. |
| 4 | LG Düsseldorf v. 10. 12. 2021, 37 O 66/20, BeckRS 2021, 62936. |
| 5 | OLG Düsseldorf v. 27. 7. 2023, VI-6 U 1/22 (Kart), NZG 2023, 1279, 1287 f. |
| 6 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23 (juris). |
| 7 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 9 (juris), unter Verweis auf BGHSt 55, 288, Rdn. 37. |
| 8 | Vgl. auch Wils, WuW 2023, 583, 587. |
| 9 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 10 f. (juris); die Vorinstanzen hatten sich noch mit einem Verbotsirrtum des Geschäftsführers befasst, diesen aber ausgeschlossen, vgl. OLG Düsseldorf NZG 2023, 1279, 1282 ff.; LG Düsseldorf v. 10. 12. 2021, 37 O 66/20, BeckRS 2021, 62936, Rdn. 29 ff. Das LG Düsseldorf war dabei nicht von einer vorsätzlichen, sondern nur von einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Geschäftsführers ausgegangen. |
| 10 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 16 ff. (juris); Wagner-von Papp, WuW 2025, 1, 2 hält dagegen weniger eine teleologische Reduktion der Vorschriften zur Organhaftung für angebracht als eine durch das Telos des Kartellrechts beeinflusste normative Bestimmung des ersatzfähigen Schadens; ähnlich Bunte, NJW 2018, 123, 125 f. |
| 11 | Vgl. nur EuGH v. 20. 9. 2001, Rs. C-453/99, Rdn. 25 ff. (Courage und Crehan); EuGH v. 13. 7. 2006, Rs. C-295/04 bis C-298/04, Rdn. 62 (Manfredi u.a.); EuGH v. 7. 12. 2010, Rs. C-439/08, Rdn. 63 (VEBIC); EuGH v. 6. 11. 2012, Rs. C-199/11, Rdn. 41 (Otis u.a.); EuGH v. 6. 6. 2013, Rs.C-536/11, Rdn. 21 (Donau Chemie u.a.); EuGH v. 5. 6. 2014, Rs. C-557/12, Rdn. 32 f. (Kone u. a.); EuGH v. 6. 10. 2021, Rs. C-882/19 (Sumal SL/Mercedes Benz Trucks España SL); EuGH v. 28. 1. 2025, Rs. C-253/23, Rdn. 71 ff. (ASG 2); zur Anwendung des Effet Utile im europäischen Kartellrecht vgl. z.B. Roth, WRP 2013, 257 ff.; ders., ZHR 179 (2015) 668 ff.; zur Anwendung des Effet Utile-Grundsatzes auf das Kapitalmarktdeliktsrecht Markworth, ZHR 183 (2019) 46 ff.; zum Effektivitätsgebot in der Schutzgesetzhaftung Grigoleit, ZIP 2023, 221 ff. |
| 12 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 18, 36 (juris). |
| 13 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 18 (juris). |
| 14 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 35 (juris). |
| 15 | LG Dortmund NZKart 2023, 443, 444; Glöckner/Müller-Tautpheus, AG 2001, 344, 349; Kersting, ZIP 2016, 1266, 1268; Kersting/May, WuW 2024, 313, 316; Bayer/Scholz, GmbHR 2015, 449, 453; MünchKomm AktG/Spindler, 6. Aufl 2023, § 93 Rdn. 211; Kapp/Hummel, ZWeR 2011, 349, 358. |
| 16 | So auch die wohl überwiegende gesellschaftsrechtliche Literatur, die teilweise die Höhe des Regresses begrenzen will: vgl. Beck OGK AktG/ Fleischer, Stand: 1. 2. 2025, § 93 Rdn. 260; MünchKomm AktG/Spindler (Fn. 15), § 93 Rdn. 211; Koch, AktG, 19. Aufl. 2025, § 93 Rdn. 88; Hopt/Roth in: Hirte/Mülbert/Roth, AktG, 5. Aufl. 2016, § 93 AktG Rdn. 419; Bayer/Scholz, GmbHR 2015, 449, 451; Glöckner/Müller-Tautpheus, AG 2001, 344, 346; Hauger/Palzer, ZGR 2015,33, 55; Thole, ZHR 173 (2009) 504, 532 ff.; Eufinger, WM 2015, 1265, 1270 f.; Nietsch, ZHR 184 (2020) 60, 69 ff. |
| 17 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 24 (juris). |
| 18 | BGHZ 23, 222 (juris Rdn. 12) = NJW 1957, 586 – Bankenhaftung; BGH, NJW 1997, 518, 519 – Steuerberaterhaftung; BGH, VersR 2011, 132 = NJOZ 2011, 460 – Steuerberaterhaftung. |
| 19 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 25 (juris) unter Verweis auf RGZ 169, 267 f.; BGHZ 41, 223 (juris Rdn. 29); BGHSt 37, 226 (juris Rdn. 61 bis 71); BGHZ 202, 26 Rdn. 12. |
| 20 | Dreher, FS Konzen, 2006, S. 85, 104; Bunte, NJW 2018, 123, 125; Baur/Holle, ZIP 2018, 459, 465; Grunewald, NZG 2016, 1121, 1122; Thomas, NZG 2014, 1409, 1413; ders., VersR 2017, 596, 599; Lotze, NZKart 2014, 162, 167; Lotze/Heyers, NZKart 2018, 29, 31; Heyers, WuW 2022, 413, 415; Scholz/Verse, GmbHG, 13. Aufl. 2024, § 43 GmbHG Rdn. 310; LAG Düsseldorf BB 2015, 907, 909 f.; OLG Düsseldorf NZG 2023, 1279 ff. |
| 21 | Dass dies keineswegs zwingend ist, ergibt sich z.B. aus dem vom LG Dortmund entschiedenen Fall, in dem der Gesellschaft sogar Verluste aus den kartellrechtswidrigen Absprachen über Bauprojekte entstanden waren, vgl. LG Dortmund NZKart 2023, 443 ff.; LG Dortmund NZKart 2023, 496 ff. |
| 22 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 28 ff. (juris). |
| 23 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 34 ff. (juris). |
| 24 | Wagner-von Papp, WuW 2025, 1, 2; zur Versicherbarkeit des Geldbußenregresses ausf. Thomas, NZG 2015, 1409, 1416 ff. |
| 25 | Kersting/May, WuW 2024, 313, 314. |
| 26 | EuGH v. 4. 10. 2018, Rs. C-384/17, Rdn. 59 m.w.N. (Link Logistik N&N); EuGH v. 8. 5. 2019, Rs. C-486/18, Rdn. 37 f. (RE/Praxair MRC); EuGH v. 11. 9. 2019, Rs. C-143/18, Rdn. 37 f. (Romano/DSL-Bank); vgl. BVerfG v. 26. 9. 2012, NJW 2012, 669, 670 f. |
| 27 | EuGH v. 4. 2. 1988, Rs. 157/86, Rdn. 11 (Murphy/An Bord Telecom Eireann); EuGH v. 28. 1. 2025, Rs. C-253/23 Rdn. 90 (ASG 2) m.w.N; vgl. zur unionsrechtskonformen Auslegung allg. Ruffert in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 1 AEUV Rdn. 24; Körber/Schweitzer/Zimmer in: Immenga/Mestmäcker, GWB, 7. Aufl. 2024, Einleitung Rdn. 11 ff.; Kersting in: Kersting/Meyer-Lindemann/Podszun, Kartellrecht, 5. Aufl. 2025, § 33a GWB Rdn. 29 ff. |
| 28 | Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 12. 2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts. |
| 29 | EuGH v. 8. 7. 1999, Rs. C-186/98 Rdn. 10 (Maria Amélia Nunes u. Evangelina de Matos); EuGH v.19. 3. 2009, Rs. C-510/06, Rdn. 149 (Archer Daniels Midland/Kommission); EuGH v. 17. 6. 2010, Rs. C 413/08 P, Rdn. 102 (Lafarge/Kommission); EuGH v. 14. 9. 2017, Rs. C-177/16, Rdn. 68 (AKKA/LAA); so auch jüngst EuGH v. 18. 1. 2024, Rs. C-128/21, Rdn. 109 ff. (Litauische Notare). |
| 30 | EuGH v. 11. 6. 2009, Rs, C-429/07, Rdn. 39 (Inspecteur van de Belastingdienst/X BV). |
| 31 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 41 f. unter Verweis auf Wils, WuW 2023, 583, 588; Wagner-von Papp, WuW, 2025, 1; Friedl/Titze, ZWeR 2015, 318, 331; vgl. zur fehlenden Vergleichbarkeit der steuerlichen Abzugsfähigkeit mit dem Innenregress Badtke/Jarass/Ekler, WuW 2025, 397, 399. |
| 32 | EuGH v. 6. 10. 2021, Rs. C-882/19 (Sumal SL/Mercedes Benz Trucks España SL); vgl. dazu Palzer, EWS 2022, 23 ff.; Kersting/Otto, NZKart 2022, 651 ff. |
| 33 | BGH NJW 1997, 1926, 1927 f.; vgl. dazu Goette in: Goette/Arnold, Handbuch Aufsichtsrat, 2. Aufl. 2024, § 4 Rdn. 2425 ff.; Grigoleit in: Hommelhoff/Hopt/Leyens, Unternehmensführung durch Vorstand und Aufsichtsrat, 2024, § 33 Rdn. 92 ff.; Bachmann, FS Krieger, 2020, S. 61 ff. |
| 34 | Für das Erfordernis einer deutlich überwiegenden Durchsetzungswahrscheinlichkeit Reichert, ZIP 2016, 1189, 1193, 1197; MünchKomm AktG/Habersack, 6. Aufl. 2023, § 111 Rdn. 39 m.w. Nachw.; Grigoleit in: Hommelhoff/Hopt/Leyens (Fn. 33), § 33 Rdn. 99. |
| 35 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 45 (juris); ebenso von Schreitter/Lauer, DB 2023, 2035, 2040 f. |
| 36 | LG Düsseldorf v. 10. 12. 2021, 37 O 66/20, BeckRS 2021, 62936, Rdn. 58.; OLG Düsseldorf, NZG 2023, 1279, 1288, Rdn. 177; kritisch dazu von Schreitter/Lauer, DB 2023, 2035, 2040 f.; Wagner-von Papp, WuW 2025, 1 f. |
| 37 | Vgl. zu den in Deutschland bis 2017 in Kartellschadensersatzprozessen ergangenen Urteilen Rengier, WuW 2018, 613 ff. |
| 38 | So auch Thomas, NZG 2015, 1409, 1414; Scholz/Verse (Fn. 20), § 43 Rdn. 300; MünchKomm GmbHG/Fleischer, 4. Aufl. 2023, § 43 Rdn. 319; Lotze, NZKart 2014, 162, 167; a.A. wegen der Präventivfunktion des Kartellschadensersatzes wohl Heyers, WuW 2022, 413, 417; zweifelnd an der Regressierbarkeit von gegen das Unternehmen gerichteten Schadenersatzforderungen auch von Schreitter/Lauer, DB 2023, 2035, 2040. |
| 39 | BGH v. 11. 2. 2025, KZR 74/23, Rdn. 38 (juris). |