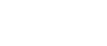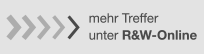Steuerpolitische Versprechen, ein schwieriges Thema

Steuerpolitische Versprechen nur Versprechen, wenig Umsetzung
Steuerpolitische Versprechen begleiten Bundestagswahlkämpfe und anschließende Regierungsbildungen seit eh und je. Sie sind nichts Neues. Ob sie nach der Wahl auch umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Am Beispiel der Senkung der Energiesteuer für alle zeigt sich, dass es mit der Umsetzung so eine Sache ist. In Zeile 956–958 heißt es: “Wir wollen Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens fünf Cent pro kWh mit einem Maßnahmenpaket entlasten. Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren.” In Euro wäre dies eine Entlastung um 5 ct./kWH gewesen. Weder im Bundeshaushalt 2025 noch in den Eckwerten des Bundeshaushaltes 2026 ergibt sich nun, dass diese Entlastung für alle kommt. Die Empörung ist groß.
Wie sieht es nun grundsätzlich mit der Umsetzung von Wahlversprechen aus? Eine Studie der Universität Konstanz zeigt, das ca. 60 % der Wahlversprechen von Regierungsparteien zumindest teilweise umgesetzt werden. Dies gilt auch für steuerpolitische Versprechen. Grundsätzlich fanden die Forscher heraus, dass die Umsetzung von konkreten überprüfbaren Zusagen eher eingehalten wird als vage formulierte Zusagen.
Einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung zur Regierungszeit der Ampel (2021–2025) nach hat die Ampel-Koalition bis zur Halbzeit der Legislaturperiode etwa 38 % ihrer Koalitionsversprechen vollständig und 26 % teilweise umgesetzt. Dies umfasst auch steuerpolitische Maßnahmen.
Die Wahrnehmung und die Realität gehen schon oft deswegen nicht im Einklang, weil vage oder symbolische Versprechen, z. B. “Steuern senken”, zum Interpretieren einladen, während dies konkrete Maßnahmen naturgemäß nicht tun.
Ein Blick auf die Ampel-Koalition zeigt, dass einige steuerpolitische Versprechen tatsächlich umgesetzt wurden. Die Ampel hob den steuerlichen Grundfreibetrag rückwirkend zum Januar 2024 um 180 Euro auf 11 784 Euro an, wie im Koalitionsvertrag versprochen. Dies sollte untere und mittlere Einkommen entlasten und die kalte Progression abmildern. Der Solidaritätszuschlag wurde partiell abgeschafft. Dagegen wurden Versprechen nicht umgesetzt. Die Steuerklassenreform für Paare, mit der eine Reform der Steuerklassen verbunden war, fiel aus. Das Versprechen von Olaf Scholz (SPD), im Wahlkampf die gesenkte Mehrwertsteuer für die Gastronomie (von 19 % auf 7 %) beizubehalten, wurde kassiert. Die Mehrwertsteuer wurde nach der Wahl wieder auf 19 % erhöht. In der medialen Berichterstattung wurde dies als “Wortbruch” des Olaf Scholz kritisiert. Auch das Versprechen der SPD “höhere Steuern für Vermögende und Spitzenverdiener” wurde nicht umgesetzt.
Die Große Koalition (2018–2021) hob den Grundfreibetrag an wie versprochen, ebenso wie Kinderfreibetrag und Kindergeld. Die versprochene umfassende Steuerreform blieb jedoch aus. Die Regierungszeit 2014–2018 brachte lediglich auch eine Erhöhung des Grundfreibetrages und die Anpassung des Kindergeldes. Mehr war es nicht. Im Koalitionsvertrag war vereinbart, dass es keine Steuererhöhungen geben sollte. Eine umfassende Unternehmenssteuerreform blieb aus.
Ein Blick weiter zurück in das Jahr 2009 zeigt, dass Angela Merkel Steuersenkungen von ca. 15. Mrd. Euro (in vier Jahren), die notwendig zur Ankurbelung der Wirtschaft seien, verteidigte, wie es im Wahlprogramm der CDU/CSU stand. Umgesetzt wurde nur wenig davon. Stattdessen wurde die Mehrwertsteuer von 16 % auf 19 % erhöht. Die Priorisierung auf die “schwarze Null” im Haushalt gab keinen Spielraum für Steuersenkungen. Die Steuersenkungen blieben weit hinter den Ankündigungen zurück, und der Spitzensteuersatz wurde nicht wie geplant angepasst (z. B. von 53 000 Euro auf 55 000 oder 60 000 Euro). Stattdessen blieb die steuerliche Belastung für viele Bürger hoch, und es gab keine spürbaren Entlastungen für die arbeitende Bevölkerung.
Die Gründe für die Nichterfüllung der Versprechen sind vielfältig. Bei jeder Regierungsbildung müssen zwangsläufig Koalitionskompromisse eingegangen werden. Damit scheitern viele steuerpolitischen Versprechen an unterschiedlichen Prioritäten. Beispielsweise blockierte die FDP in der Ampel Steuererhöhungen für Reiche, während SPD und Grüne diese priorisierten. Auch die finanzielle Lage steht den Versprechungen im Wege, führen Steuersenkungen zwangsläufig zu Mindereinnahmen. Ebenso können die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen die Regierungen zwingen, Wahlversprechen anzupassen oder aufzugeben, weil sie schlicht nicht finanziert werden können. Bleibt zum Schluss noch die gefühlte Wahrnehmung. Vage Versprechen wie “Steuergerechtigkeit” oder “Entlastung der Mitte” werden oft nicht als erfüllt wahrgenommen, selbst wenn konkrete Maßnahmen (z. B. Grundfreibetrag) umgesetzt werden. Ebenso darf nicht verschwiegen werden, dass die Versprechungen, die den Grundfreibetrag und das Kindergeld betreffen, oftmals von Verfassungs wegen geboten sind und quasi als Scheinversprechen daherkommen.
Insoweit reiht sich die jetzige Regierung in die Tradition der Vorgängerregierungen ein. Fehlende finanzielle Spielräume und wirtschaftliche Rahmenbedingungen verhindern die Umsetzung von steuerpolitischen Versprechungen, wie am Beispiel der Senkung der Stromsteuer für alle deutlich wird. Unverständlich sind die Versprechungen dann, wenn bereits feststeht, dass die finanziellen Spielräume nicht vorhanden sind. Völlig unglaubwürdig wird es, wenn die versprochenen Senkungen durch Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden sollen. Vielleicht sollten die Beteiligten es einmal mit der Wahrheit probieren oder verträgt der Wähler die Wahrheit nicht?
Prof. Dr. iur. Michael Stahlschmidt lehrt an der FHDW Paderborn Steuerrecht, Rechnungswesen, Controlling und Compliance und ist Ressortleiter des Ressorts Steuerrecht des Betriebs-Berater und Schriftleiter Der SteuerBerater.