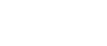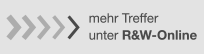Pflicht zur erfolgreichen Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive im zweiten Anlauf

Es gibt ohne erheblichen Reputationsschaden keinen dritten Versuch.
Wenn man ein gesetztes Ziel verpasst, kann man entweder aufgeben oder man nimmt einen erneuten Anlauf. Die Nichtumsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, ABlEU vom 16.12.2022, L 322, 15) in deutsches Recht ist keine Option: Es läuft nicht nur bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union (EU) gegen Deutschland, auch die Unsicherheit für die in der CSRD angesprochenen, nach nationalem Recht aber bislang nicht einbezogenen Unternehmen ist aufzulösen. Zur Erhöhung der Erfolgschancen sollte man beim zweiten Anlauf besser vorbereitet sein, insbesondere die Gründe für das Scheitern im ersten Versuch verstanden haben. Bereits 2024 war absehbar, dass das Rahmenwerk der CSRD deutlich entschlackt werden muss, die vorgesehenen Berichtspflichten also überbordend und belastend sind. Die tatsächliche Nichtumsetzung war aber mehr die Folge des Scheiterns der Ampelregierung. Für die europäische Position, insbesondere die ambitioniert gesteckten Ziele des EU Green Deal, war das deutsche Handeln ein Rückschlag.
Die sich aufdrängende Frage ist nun: Wird im zweiten Anlauf alles anders? Nach Vorlage eines Referentenentwurfs im Juli 2025 (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_ CSRD_ UmsG_ 2025.pdf?_ _ blob=publicationFile&v=3, Abruf: 22.9.2025) liegt nun nur zwei Monate später der Regierungsentwurf (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_ CSRD_ UmsG.pdf?_ _ blob=publicationFile&v=2, Abruf: 22.9.2025) des deutschen Gesetzes zur Umsetzung der CSRD vor. Inhaltlich haben sich – die Aufnahme der Stop-the-Clock-Richtlinie (RL (EU) 2025/794, ABlEU vom 16.4.2025, L 2025, 794) ausgeklammert – fast keine Änderungen im Vergleich zum nicht weiterverfolgten Referentenentwurf von 2024 (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_ CSRD_ UmsG.pdf?_ _ blob=publicationFile&v=3, Abruf: 22.9.2025) eingestellt. Es bleibt also bei der beabsichtigten 1:1-Umsetzung der CSRD. Die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts hat durch einen Wirtschaftsprüfer, nicht notwendigerweise den bestellten Abschlussprüfer, zu erfolgen. Es wird auch nur eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit gefordert, die für die anderen Informationen im Finanzbericht nicht ausreichend ist. Trotz der schwindenden Relevanz der eXtensible-Business-Reporting-Language-(XBRL-) Technologie soll für Geschäftsjahre ab 2026 weiterhin das digitale Tagging von Informationen erfolgen. Enttäuschend bleibt im Kontext der XBRL-Anforderung die fehlende Auseinandersetzung mit der bei der elektronischen Berichterstattung schwelenden Frage, ob die bisher gelebte “Offenlegungslösung” oder die weiterhin im Regierungsentwurf vorgesehene “Aufstellungslösung” vorzugswürdig ist. Wenigstens beim Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz lassen sich Erleichterungen feststellen.
Aktuell ist eine Umsetzung der CSRD in deutsches Recht im zweiten Anlauf noch in diesem Jahr wahrscheinlich, sicher ist das aber noch nicht. Die umfangreichen Berichtsanforderungen nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) stehen immer noch im Raum. Der Regierungsentwurf berücksichtigt die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen – allerdings noch nicht abschließend beschlossenen – neuen Schwellenwerte für Mitarbeitende und befreit große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit weniger als 1 000 Mitarbeitenden von der Berichtspflicht. Die aktuell noch laufenden Diskussionen zur Anpassung der CSRD (u. a. Value Chain Cap und die Reduzierung der ESRS-Berichtsstandards) sind noch nicht beendet; in welchem Umfang noch weitere, insbesondere inhaltliche Erleichterungen kommen, ist damit offen. Die in Aussicht gestellte Änderungsrichtlinie COM(2025) mit zahlreichen Anpassungen an der CSRD muss noch den weiteren EU-Gesetzgebungsprozess unter Beteiligung des Europäischen Parlaments und des Rats durchlaufen und kann erst danach in nationales Recht umgesetzt werden.
Eine Umsetzung des aktuellen Stands der CSRD in deutsches Recht bringt im direkten Vergleich mit 2024 nur wenig Neues. Für große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die bisher in den Anwendungskreis der Non-Financial Reporting Directive fallen, besteht Sicherheit: Die Berichterstattung und Prüfung hat im Einklang mit der CSRD und den ESRS zu erfolgen. Bezogen auf Umfang und Reichweite der CSRD bleiben aber weitere relevante Fragen offen, insbesondere ob der versprochene Bürokratieabbau tatsächlich erfolgt. Die entscheidende Ausgangsfrage ist: Wieviel Transparenz über nachhaltiges Wirtschaften ist notwendig? Im Detail geht es dann auch darum, welche Information besondere Bedeutung hat, also ob es eine Hierarchie zwischen Environmental, Social und Governance-(ESG-)Angaben gibt und ob manche Datenpunkte wichtiger sind als andere. Welche ESG-Angaben geben wirklich Auskunft über Langlebigkeit und Resilienz des betrachteten Geschäftsmodels? Entscheidend für die weitere Verknüpfung von Nachhaltigkeitsleistung und Unternehmensleistung sowie für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen im internationalen Vergleich ist die Einbettung des europäischen Nachhaltigkeitsberichts in den Kanon der internationalen Rahmenwerke, insbesondere die Interoperabilität mit den Standards des International Sustainability Standards Board (ISSB) IFRS S1 und IFRS S2. Durch sprachliche Angleichungen und einheitliche Auslegung der Anforderungen des – den ESRS und den IFRS S-Standards zugrundeliegenden – Greenhouse-Gas-Protokolls kann bereits eine deutliche Vereinheitlichung erreicht werden. Für Europa und das europäische Ideal des Nachhaltigkeitsberichts ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Nachbesserung der CSRD im zweiten Anlauf glückt. Für die Umsetzung der CSRD in deutsches Recht gibt es ohne einen erheblichen Reputationsschaden keinen dritten Versuch – denn in diesem Fall sind nicht aller guten Dinge drei.
Dr. Jens Freiberg, WP, ist Mitglied des Vorstands der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitglied im Beirat des “Betriebs-Berater”.