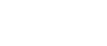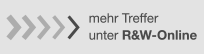Nachhaltigkeitsberichterstattung: Kommen jetzt die “ESRS light”?

Weniger ESRS-Datenpunkte bedeuten nicht automatisch weniger Aufwand für die Unternehmen.
Die Europäische Kommission will Berichtspflichten um 25 % reduzieren – ein Entbürokratisierungsziel, das in Zeiten von schwächelnder Konjunktur und Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen Entlastung verspricht. Diesen Bürokratieabbau betonte auch die Pressemeldung, mit der die EFRAG Ende Juli den Reformentwurf der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bekanntgab: “In total, mandatory datapoints (to be reported if material) have been cut by 57 %”.
Doch wie viel “Speck” würde durch diese “ESRS Set 2” wirklich abgeschnitten? In welchem Umfang werden die 2025er ESRS-Berichte gegenüber dem Vorjahr “schlanker” ausfallen? Und ist es sachgerecht, diese wichtige Diskussion anhand der Anzahl der einzelnen “Datenpunkte” zu führen, die die aktuellen ESRS Set 1 vorschreiben – und die in ESRS Set 2 entweder wegfallen, als freiwillig deklariert hinzukommen oder geändert werden sollen?
Eine aktuelle Datenpunktanalyse des Sustainability Reporting Navigator (SRN; www.srnav.com) gibt erste empirische Hinweise: Sie verknüpft die vorgeschlagene Datenpunktliste für ESRS Set 2 mit den von mehr als 700 EU-Unternehmen in ihren 2024er ESRS-Berichten als wesentlich eingestuften (und damit tatsächlich befolgten) Angabepflichten. Das Ergebnis: Die Zahl der verpflichtenden Datenpunkte sinkt im Durchschnitt um 49 % – von 557 auf 287. Am stärksten gehen mit 56 % die qualitativen Angaben zurück, während quantitative Datenpunkte um 29 % reduziert werden sollen. Besonders stark von der Reduktion betroffen wären diejenigen qualitativen Datenpunkte, die nach einer Äußerung der Initiative Principles for Responsible Investment aus der Sicht nachhaltigkeitsorientierter Investoren entbehrlich sind. Auf den ersten Blick brächte die ESRS-Reform damit eine willkommene Entlastung für die Ersteller – ohne dass ihr allzu viele anlagerelevante Informationen zum Opfer fielen.
Doch der Teufel steckt im Detail: 67 % der verbleibenden Datenpunkte sind neu oder substanziell geändert. Für die Unternehmen bedeutet das nicht nur weniger, sondern auch andere Anforderungen – und damit mögliche Umstellungskosten. Hier setzt eine interne Befragung des Arbeitskreises Externe Unternehmensberichterstattung (AKEU) der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaftslehre e. V. (https://schmalenbach.org/images/stories/Fotos/Arbeitskreise/Externe_ Unternehmensrechnung/2025-09-29_ AKEU_ comments_ on_ amended_ ESRS_ letter_ and_ survey_ FINAL.pdf, Abruf: 10.10.2025) an: Dabei gaben Unternehmensvertreter und Wirtschaftsprüfer im AKEU an, welche dieser Änderungen tatsächlich zu einer Kostenentlastung führen – und welche eventuell sogar zusätzliche Ressourcen binden. Diese Kombination aus statistischen Daten aus der SRN-Analyse und direkter Praxiseinschätzung durch die AKEU-Mitglieder erlaubt es, dem “Nettoeffekt” der ESRS-Reform auf die Erstellungskosten der Unternehmen näherzukommen. Das ist entscheidend, um der EFRAG differenzierte Rückmeldungen zu geben: Wo sind echte Vereinfachungen gelungen? Wo drohen unbeabsichtigte Mehrbelastungen? Und wie kann die zukünftige Entwicklung der ESRS klüger gesteuert werden – weg von bloßem “Datenpunktmarketing”?
Die Ergebnisse dieser AKEU-Befragung zeichnen ein ernüchterndes Bild: Kostensenkungen bleiben begrenzt, weil die aufwendigsten quantitativen Datenpunkte – etwa zu Scope-3-Emissionen, Vergütung oder Lieferketten – unverändert verpflichtend sind. Zwar begrüßen Unternehmen die Streichung vieler qualitativer Datenpunkte, 67 % erwarten jedoch nur sehr geringe und 25 % gar keine Kostenreduktion. Hinzu kommt, dass neue und geänderte Anforderungen – etwa detailliertere Mitarbeiterangaben, “adequate wages” oder neue Umweltkennzahlen – zusätzliche Belastungen verursachen. Erleichterungen wie die Möglichkeit, Schätzungen zu verwenden, werden zwar positiv gesehen, bringen aber kaum echte Einsparungen. Zwar planen nur wenige Unternehmen eine freiwillige Befolgung gelöschter Angabepflichten, jedoch verursacht schon der laufende Revisions- und Konsultationsprozess selbst erhebliche Umstellungs- und Abstimmungsaufwände. Das Fazit: Von einem großen Wurf hin zu “ESRS light” kann aus Sicht der befragten Unternehmen und Wirtschaftsprüfer bislang keine Rede sein.
Zudem fehlt eine wichtige Variable in der Gleichung: der Nutzen der ESRS-Angaben für die Adressaten. Hier tappt man leider immer noch weitgehend im Dunkeln – jedenfalls was empirische Evidenz auf dem Detailniveau einzelner Datenpunkte angeht. Folglich wird die Diskussion um die ESRS sehr stark von Kostenargumenten der Erstellerseite dominiert – die möglicherweise erheblichen Nutzenzuwächse für verschiedene Stakeholdergruppen spielen hingegen kaum eine Rolle. Erste Analysen der Nutzung von Online-Geschäftsberichten durch den SRN zeigen, dass im Durchschnitt mehr als ein Drittel der Zugriffe den ESRS-Nachhaltigkeitsbericht zum Ziel haben – ein etwa ebenso hoher Anteil entfällt auf die Finanzberichterstattung in IFRS-Abschluss und Lagebericht.
Am 29.9.2025 endete die Konsultationsfrist für den Entwurf der ESRS Set 2. Nun liegt es an der EFRAG, die zahlreichen Konsultationseingaben zu sichten, sachgerecht zu gewichten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Dabei ist zu hoffen, dass auch die Nutzerperspektive ausreichend vertreten ist und Berücksichtigung findet. Für die Akzeptanz der künftigen ESRS Set 2 ist es zudem wichtig, dass die EFRAG die Ergebnisse der Konsultation sowie die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen transparent offenlegt.
Prof. Dr. Thorsten Sellhorn lehrt und forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Fragen der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Er ist u. a. Mitglied des European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) Academic Panel, des International Financial Reporting Standards (IFRS) Advisory Council, des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) sowie wissenschaftlicher Leiter des Arbeitskreises Externe Unternehmensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft.